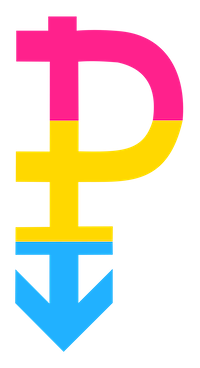Langsam erwachte er. Seine glühenden Augen öffneten sich und schauten verunsichert auf die Ebene, die vor ihm lag. Lange schon hatte Theoten diese Welt nicht mehr betreten. Damals kannte man ihn hier noch als Theton. Doch er hatte sich verändert.
Es war seine Welt. Eine Welt, die niemand mit ihm teilen wollte. In ihr wurde jede Schönheit zu einem Wesen der Finsternis. Eine finstere Schönheit, die nur wenige überhaupt erkennen konnten. Doch auch sie hatte sich verändert. So wie er sie nun erblickte, kannte Theoten diese Welt nicht. Überall wucherten schleimige Tentakel. Viele unbekannte Gesichter schauten ihn mit verabscheuendem Blick an.
Es war nicht mehr seine Welt. Sie fühlte sie sich fremd an. Verschwunden war die dunkle Ästhetik, die einst hier herrschte. Er fühlte nicht mehr die Ruhe der Dunkelheit, in die er früher so gern gesunken war. Verschwunden waren die verschlungenen Schattengebilde, die die Wege überwölbten. Keine blutrote Lava floss mehr die Berge in der Ferne hinab. Die magischen Tore lagen umgestürzt und zerbrochen auf der Ebene verteilt. Überall lärmte nun das Chaos und es stank entsetzlich nach Siechtum. Unangenehm grelle Lichtblitze tauchten immer wieder die Ebene vor ihm in ein taghelles Licht. Der Blutbach, der einst an dieser Stelle entlang floss, war nunmehr nur noch ein stinkendes mit schwarzer Brühe gefülltes Rinnsal. Verschwunden war seine lebensspendende Wirkung. Stattdessen schien er nun Verderbnis in die Lande – seine Lande – zu tragen.
Immer zorniger wurde sein Blick als er seinen Blick über die Ebene schweifen ließ. Was er sah, verabscheute er. Wie konnte es nur so weit kommen? Hatten seine Wächter versagt? Oder hatte er seine Wächter im Stich gelassen, als sie nach ihm riefen? Die Bewusstwerdung traf ihn wie ein Schlag und er sank vornüber auf die Knie, während er seine Verzweiflung aus seinen Lungen schrie. Wütend über sich selbst, riss er die glänzende Rüstung von seinem dämonischen Leib, bis kein Glanz mehr an ihm blieb. Dann stand er auf und ließ einen Schrei über die Lande erschallen, der den Boden zum Beben brachte, Felsen zerbarst und die chaotischen Kräfte erzittern ließ. Dieser Schrei war ein Ruf zu den Waffen. Er musste nicht lange warten.
Aus dem Boden vor ihm stieß eine Klaue durch die Oberfläche und erdverkrustet erhob sich Marial, das Erdenbiest, aus der Finsternis des Erdreiches. Er riss seinen Kriegshammer in die Luft und beantwortete den Ruf. Theoten spürte, wie der modrige Atem ihm in’s Gesicht schlug, als Marial ihn anblickte. Und er lächelte ein Lächeln, das allen Fremden in diesem Land eine Warnung sein sollte. Wer sich nun nicht zu ihm bekannte, würde vernichtet werden.
Nach und nach fanden sich immer mehr ein. Schitol, der einst als Schatten zu ihm kam und den er zu einem wunderschönen Dämon formte. Gord, das Flammenwesen, das er einst als Kind aus einer unscheinbaren Kerzenflamme erschuf. Mikta, die Cyborg, das einzige Wesen, das zu einer direkten geistigen Verbindung mit ihm fähig war. Engila, seine Priesterin, die ihm mit ihren Zaubern schon seit seiner Kindheit zur Seite stand. Menovil, der Geheimnisvolle, dessen Antlitz noch niemand je gesehen hat. Auch sein Schattenselbst schloss sich ihm an. Und viele weitere Dämonen versammelten sich um ihn.
Und mit ihnen kam eine Armee aus Schatten, blinden Wächtern und dunklen Engeln. Jeden Einzelnen erkannte er wieder. In ihren Auren sah er Ergebenheit und Treue. Sie waren bereit für ihn zu sterben. Sie alle waren seinem Ruf gefolgt und erwarteten nun seine Befehle.
Langsam richtete Theoten sich zu seiner vollen Größe auf und entfaltete jedes einzelne seiner Körperteile. Dann richtete er sich mit dröhnender Stimme an seine Krieger: „Meine Freunde! Ja, ich nenne euch meine Freunde. Denn ich sehe, dass ihr mit mir verbunden geblieben seid, über all die Jahre, in denen ich nicht an eurer Seite war. Ohne Umschweife seid ihr meinem Ruf gefolgt. Und nun will ich euch erklären, warum dieser Ruf erschallte.
Lange schon wurden in dieser Welt keine Schlachten mehr geschlagen. Ich weiß nun, dass ihr die letzten Jahre viele Kämpfe austragen musstet. Doch diesmal werden wir nicht nur Kämpfe austragen. An meiner Seite werdet ihr kämpfen um dieses Land wieder von dem Übel zu befreien, das es befallen hat. Wer nicht zu uns steht, der wird heute vernichtet werden. Und jeden flüchtigen Feigling werden wir jagen, bis auch der letzte Widersacher ausgemerzt ist. Dies ist meine Welt! Ich regiere hier! Und ich lasse nicht zu, dass irgendwelche Kräfte versuchen sie zu vernichten! Ihr alle seid meine Kinder, doch diese Pest da draußen ist es nicht. Sie gehören nicht in diese Welt!
Ich weiß, dass ich zu lange gewartet habe. Viele eurer Brüder und Schwestern sind gefallen, weil ich nicht an ihrer Seite war. Doch dies wird nie wieder geschehen. Nie wieder werde ich bereit sein diese Welt zu verleugnen, in der so viele Freunde leben, die sich selbst nach so langer Zeit ohne Umschweife wieder an meine Seite stellen.
Lasst uns nun durch unsere Lande ziehen und sie befreien. Was hinter uns zurückbleibt, wird Wüste sein. Eine Wüste, aus der ich neues Leben entspringen lassen kann.“
Ein Kriegsgeschrei schloss seine Rede ab, in das nach seinen Heerführern auch die ganze Armee einstimmte. Mit weiten Schritten betrat Theoten die Ebene vor ihm. Dort hatten sich zwischen Abermillionen von Tentakeln Dämonen versammelt. Hässliche Kreaturen, von denen nur eine Aura von Abscheu und Ekel ausging. Sie blickten ihnen erwartungsvoll entgegen und lachten frech, als er sein Schwert hob und zum Angriff rief. Doch ihr Lachen währte nicht lange. Unbarmherzig metzelte sich Theoten durch ihre Reihen. Wer sich in den Weg stellte, wurde durchbohrt, in Stücke gehackt oder von seinen Klauen und Zähnen zerfleischt. Selbst Verletzte, die am Boden lagen, wurden nicht verschont. Stunde um Stunde verhallte im Schlachtenlärm und die Reihe von Theotens Armee zog immer weiter über die Ebene. Was hinter ihr zurückblieb waren tote und brennende Leiber.
Theoten selbst ging an der Spitze seiner Truppen und sein martialisches Brüllen begleitete jeden seiner Schläge. Immer wieder wurde auch er von Äxten, Schwertern und Keulen getroffen, doch jede Wunde, die ihm gerissen wurde, beantwortete er mit noch mehr Zorn auf alles, was die Schönheit seiner Lande störte. Selbst der strahlende Engel, der sich ihm in den Weg stellte, bekam nur einen kurzen Kampf bevor er zu Boden ging und Theoten sich auf ihn stürzte um seine Kehle mit den Zähnen zu zerfetzen. Dämonen, die in ihrer Abscheulichkeit vor ihm auf die Knie sanken und um einen Platz in seiner Welt bettelten, fanden keine Gnade.
Ein Geruch von verbranntem Fleisch und Blut legte sich über das Land. Und dann war es plötzlich still, als Theoten sein Schwert aus dem Leib eines Dämons zog, den er gerade besiegte. Nichts war mehr zu hören, außer das gelegentliche Herabrollen von Steinen in den Bergen, die vermutlich von flüchtenden Gegnern losgetreten wurden, und dem leisen Klirren der Rüstungen seiner Armee. Erst jetzt wurde Theoten gewahr, dass sie die Bergkette erreicht hatten, hinter der eine Welt lag, die selbst er nur selten besuchte. Aus unzähligen Wunden blutend stieg Theoten auf einen Felsen und schaute sich sein Werk an. Nichts war mehr geblieben. Die Reihen seiner Armee waren zwar gelichtet, doch hinter ihnen erstreckte sich bis zum Horizont ein Feld aus toten Leibern. Vereinzelt züngelten immer wieder Tentakel zwischen ihnen hervor, doch sie wurden von dunklen Engeln angegriffen, die die Nachhut bildeten und ihr grauenvolles Werk, das Töten der Überlebenden, offenbar mit viel Freude ausführten.
„Holt euch den Rest!“, wies er Menovil an, der daraufhin mit einem schrillen Schrei die blinden Wächter um sich sammelte und mit ihnen in die Berge stürmte. Als sie verschwunden waren, öffnete Theoten sein Maul und ließ einen Siegesschrei los, der jedoch in einem verzweifelten Schluchzen endete, als er gewahr wurde, dass zwischen all dein Leibern Gord lag. Erloschen war sein Feuer und sein Leib sah nun aus wie ein Blick in das Nichts.
Theoten blieb stumm neben ihm sitzen. Mit jedem Atemzug füllte das Nichts ihn mehr und mehr aus, während er den toten Gord betrachtete. Zweifel kamen in ihm auf, ob diese Schlacht ein solches Opfer wirklich wert war. Verzweifelt riss er seinen Brustkorb auf und drückte den toten Leib Gords an sein nun offen liegendes Herz. Tränen rannen über sein Gesicht. Und mit ihnen floss viel seines Selbst aus ihm heraus. Er verlor in diesem Moment seinen Respekt vor sich selbst. Er verlor seine Leidenschaft. Und selbst sein Wille zum Leben blieb nur noch als kleiner Funke enthalten.
Als er Gords Leib langsam zu Boden sinken ließ, fiel ein Gebilde aus Theotens Brust, das so filigran war, dass er sich kaum traute es zu berühren. Sehr vorsichtig nahm er es in seine dämonische Klaue auf. Und während er es so betrachtete, nahm er etwas wahr, das er schon vor Jahrzehnten verloren glaubte. Er spürte Liebe und er spürte, wie diese ihn zu dem fremden Land zog, dessen Grenzen am Horizont leuchteten.
Er folgte diesem Drang und ging mit dem filigranen Gebilde, das so verletzlich in seinen Klauen wirkte, zu den Mauern. Immer wieder schossen Tentakel auf seinem Weg aus dem Boden, doch er hieb sie mit seinem Schwert beiseite und ließ nicht zu, dass sie der Liebe etwas anhaben konnten. Vereinzelt stellten sich ihm auch Abtrünnige in den Weg, die wohl die Hoffnung hatten, dass sie ihn besiegen könnten, wenn er allein war. Doch noch war sein Zorn nicht verraucht. Und mit diesem Zorn vernichtete er jeden, der sich ihm in den Weg stellte.
Vor den Mauern angekommen, rief er laut: „Ich bringe euch etwas, das in euer Land gehört!“ Als Antwort erhielt er jedoch nur einen Pfeilhagel, so dass er Mühe hatte die Liebe vor Schaden zu bewahren. Als er wieder ausreichend Abstand hatte, schaute er an sich herunter. Überall in seinem Leib steckten Pfeile, die er zornig aus seinem Fleisch riss. Was sollte er nun mit diesem Gebilde in seinem Klauen anfangen?
Als er so in Gedanken versunken in Richtung der Berge lief, hörte er ein Schluchzen und wie ein Stromschlag durchfuhr es ihn. Er hatte sich so sehr auf die Schlacht konzentriert und dabei ganz seine Aufgabe in dieser Welt vergessen. Vorsichtig folgte er dem Schluchzen und Wimmern. Und schließlich fand er wonach er suchte.
Zwischen den toten Leibern von dunklen Engeln hockte sie. Ihre langen schwarzen Haare umrahmten ihr trauriges Gesicht. Die Engel hatten sie bis zum Schluss verteidigt. Als sie den Blick hob und ihn aus rotgeweinten Augen anschaute, ließ er das Schwert sinken und tiefe Traurigkeit erfasste sein noch immer offen liegendes Herz. Blut weinend sank er neben ihr auf den Boden und flüsterte: „Bitte verzeih mir!“ Mit einem traurigen Lächeln ließ sie sich in seine offene Brust sinken bis ihre Lippen sein blutendes Herz berührten und ihr Kopf auf seiner Lunge ruhte. Und während sie so dort in ihn gekuschelt lag, ergoss sich ein Strom aus Blut über ihren Leib, der aus Theotens Augen rann. Sanft legte er seine Arme um sie.
Als sie sich viele Stunden später wieder von ihm löste und aufstand, entsprang dort, wo sie gesessen hatte, eine Quelle, aus der reines Blut sprudelte, das sich zu einem neuen kleinen Bach ergoss. Sie nahm ihn bei der Hand und führte ihn zurück zu den Bergen. Dort stieg sie mit ihm auf einen Felsen und wendete ihren Blick zurück zur Ebene. Mit einer Geste über die Ebene flüsterte sie: „Wird es helfen?“ Theoten kniete sich neben sie. „Es wird mir helfen, doch wird es im Außen wieder vieles zerstören. So wie es damals, als wir die letzte Schlacht schlugen, alles zerstört hat.“ Wieder ging sein Blick zu den Mauern, die in der Ferne leuchteten, und er fügte hinzu: „Nur diesmal werde ich keine Unterstützung mehr haben. Und ich muss aufpassen, dass dies nicht zerbricht.“ Dabei hielt er ihr das filigrane Gebilde in seiner Klaue entgegen. Vorsichtig berührte sie es mit den Fingerspitzen. Dann schenkte sie ihm wieder ihr trauriges Lächeln. „Es ist deine Schlacht.“ Verstehend nickte er. Doch dann wies er auf seinen Körper. „Werde ich diese Schlacht in diesem Zustand gewinnen können?“, fragte er. „Das hängt davon ab, ob du dies dort vor Schaden bewahren kannst.“, erhielt er als Antwort, während sie auf seine Klaue zeigte, die vorsichtig die Liebe umschloss. „Wenn du es verlierst, wirst du dich verlieren. Wenn du es zerstörst, wird es dich zerstören. Und du wirst einer von denen werden.“ Dabei deutete sie auf die Leichen in der Ebene.
„Wird es einen neuen Gord geben?“, fragte Theoten nach einigen Minuten des Schweigens und seine Begleiterin wies wieder auf seine Klaue: „Der Funke dazu ist darin verborgen. Doch allein wirst du ihn nicht erstrahlen lassen können. Gord kann nur erstrahlen, wenn er sein Feuer teilen kann.“ Noch einige Zeit knieten sie auf dem Felsen und ließen ihre Blicke über das Schlachtfeld gleiten. Dann endlich stand Theoten auf und ging auf einen Weg zu, der in die Berge führte. Und so wie sie es bereits als kleines Mädchen getan hatte, folgte sie ihm, denn sie wusste, dass ihr bei ihm kein Leid widerfahren würde. Er würde sie beschützen.